Alexander Meyer B.Eng.
Teamleiter | Vertrieb

Alexander Meyer B.Eng.
Teamleiter | Vertrieb

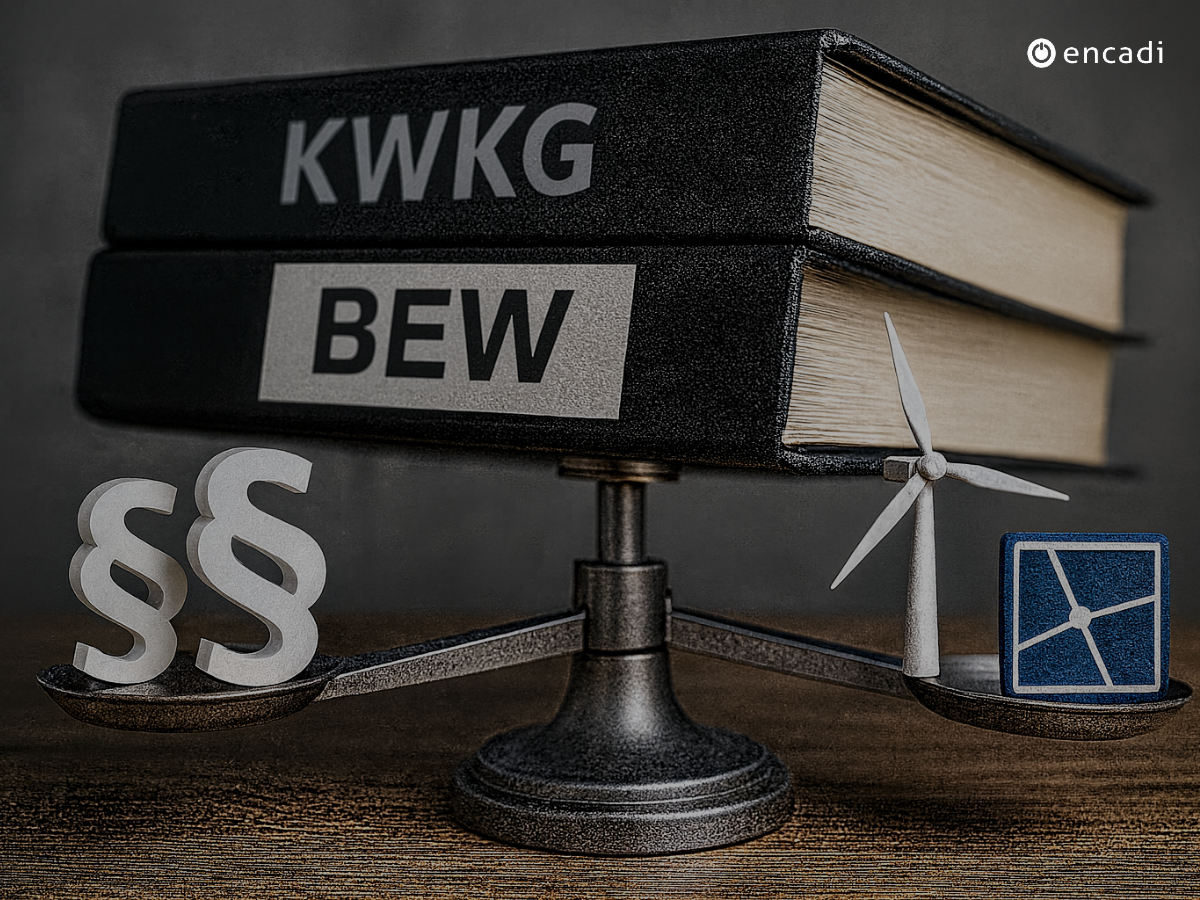

CDU/CSU und SPD bekennen sich in ihrem Koalitionsvertrag klar zum Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Besonders im Wärmesektor besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Um die leitungsgebundene Wärmeversorgung zukunftsfähig zu gestalten, setzt die Bundesregierung auf zwei zentrale Förderinstrumente: das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Beide Programme spielen eine Schlüsselrolle beim Ausbau klimaneutraler Infrastrukturen und bei der Transformation bestehender Wärmenetze. Dass der Koalitionsvertrag diese Instrumente ausdrücklich benennt, unterstreicht ihre zentrale Bedeutung für eine erfolgreiche Wärmewende in Deutschland.
Zwischenzeitlich stand die Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) auf der Kippe. Nun stellt die schwarz-rote Bundesregierung klar: Das KWKG soll erhalten bleiben und noch im Jahr 2025 weiterentwickelt werden. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) müssten konsequent und langfristig genutzt werden. Das KWKG solle daher noch im Jahr 2025 an die Anforderungen einer klimaneutralen Wärmeversorgung, an notwendige Flexibilitäten sowie im Hinblick auf einen Kapazitätsmechanismus angepasst werden.
Bereits Anfang 2025 hatte die vorherige Ampel-Regierung mit dem sogenannten „KWKG 2025“ eine Reform auf den Weg gebracht. Dieses ist zum 1. April 2025 in Kraft getreten. Ziel war es, die Förderung für KWK-Anlagen sowie für Wärme-, Kälte- und Speicherinfrastrukturen zu verlängern. Dabei wurden auch wichtige Definitionen im Gesetz – wie etwa „Wärme aus erneuerbaren Energien“ und „unvermeidbare Abwärme“ – an das neue Wärmeplanungsgesetz (WPG) angepasst. Das schafft Planungssicherheit und sorgt für mehr Klarheit bei den Mindestwärmeanteilen im Förderkontext.
Wie genau eine zweite KWKG-Novelle im Laufe des Jahres aussehen soll, bleibt im Koalitionsvertrag offen. Klar ist jedoch: Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss der Einsatz fossiler Brennstoffe deutlich reduziert werden. Ein modernisiertes KWKG könnte daher vorsehen, dass erdgasbetriebene KWK-Anlagen künftig nur noch ergänzend eingesetzt werden – vor allem dann, wenn der Strommarkt entsprechende Impulse gibt.
Um dem Ziel einer dekarbonisierten Wärmeversorgung näherzukommen, dürfte die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien (EE-Wärme) im Rahmen des KWKG weiter gestärkt werden. Besonders im Fokus stehen dabei innovative KWK-Systeme (iKWK), die klassische KWK-Anlagen mit erneuerbaren Wärmeerzeugungstechnologien und elektrischen Wärmeerzeugern kombinieren. Diese Systeme bieten nicht nur ein hohes Maß an Flexibilität, sondern auch ein großes Potenzial für die Integration erneuerbarer Wärme in bestehende Infrastrukturen.
Aktuell ist die Förderung solcher iKWK-Systeme – ebenso wie die von KWK-Anlagen im Leistungsbereich zwischen 500 kWel und 50 MWel – an die Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur geknüpft. Diese Regelung läuft jedoch Ende 2025 aus. Bislang hat die Bundesregierung keinen Vorschlag für die Verteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens ab dem Jahr 2026 vorgelegt.
Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der stark überzeichneten Ausschreibungsrunde im Juni verbleibt lediglich noch ein Gebotstermin: der 1. Dezember 2025. Ob und in welcher Form die Ausschreibungen darüber hinaus fortgeführt werden, ist derzeit offen – ebenso wie die Frage, welchen rechtlichen Spielraum der Gesetzgeber bei der Weiterentwicklung des KWKG künftig hat. Hier spielt auch der laufende Rechtsstreit zur beihilferechtlichen Einstufung des KWKG eine entscheidende Rolle.
Seit ihrem Inkrafttreten im September 2022 hat sich die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) als wichtiges Instrument zur Unterstützung der Wärmewende etabliert. Sie fördert nicht nur den Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen sowie Speichern, sondern auch die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Wärme. Das Interesse ist groß: Allein im Jahr 2024 gingen beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mehr als 1.500 Anträge ein. Das BAFA ist für die Umsetzung sowohl der BEW als auch der Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) verantwortlich.
Trotz der positiven Bilanz in der Antragslage zeigt sich in der Umsetzung eine zentrale Schwäche: Die BEW ist bislang lediglich als Förderrichtlinie ausgestaltet – und damit nicht rechtlich bindend. Selbst bei vollständiger Erfüllung aller Kriterien besteht kein Anspruch auf eine Förderung. Im Gegensatz zum KWKG, das einen gesetzlichen Förderrahmen bietet, hängt die BEW von der Verfügbarkeit staatlicher Mittel ab. Besonders deutlich wurde dies Ende 2023, als das Bundesfinanzministerium infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts eine Haushaltssperre verhängte. Die Folge: ein temporärer Antragsstopp.
Die fehlende rechtliche Absicherung erschwert auch die Finanzierung durch Fremdkapital. Projektverantwortliche dürfen in der Regel erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids mit der Umsetzung beginnen – ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn würde den Förderanspruch gefährden. Doch bis zur Bewilligung vergehen häufig mehrere Monate, in denen Projekte auf Eis liegen. Hinzu kommt: Die aktuelle Förderrichtlinie ist zunächst nur bis September 2028 gültig – für langfristig angelegte Vorhaben fehlt es damit an Planungssicherheit.
Vor diesem Hintergrund werden Rufe nach einer gesetzlichen Verankerung der BEW immer lauter. Kritisiert wird vor allem die Unsicherheit in Bezug auf Finanzierungsgrundlagen und Förderkontinuität. Die neue Bundesregierung greift diese Forderungen nun auf: CDU/CSU und SPD kündigen in ihrem Koalitionsvertrag an, die BEW künftig rechtlich abzusichern und finanziell aufzustocken, um den Ausbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung gezielt zu unterstützen.
Derzeit speist sich das Förderprogramm aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP), der durch die EU-Initiative „NextGenerationEU“ finanziert wird. Da der Bundeshaushalt für 2025 bislang nicht verabschiedet wurde, hat das Bundesfinanzministerium im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von bis zu 305 Millionen Euro bewilligt – ein vorläufiges Signal, das jedoch keinen Ersatz für langfristige Planungssicherheit darstellt.
Im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das Jahr 2025 sind – wie bereits im ersten Entwurf der vorherigen Ampel-Koalition – Fördermittel in Höhe von rund 1,021 Milliarden Euro für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahresentwurf steigen damit die Verpflichtungsermächtigungen für die Titel „Transformation Wärmenetze“ und „Zuschüsse für den Betrieb dekarbonisierter Wärmeinfrastrukturen“. Damit setzt die Bundesregierung ein Signal: Das BEW soll – wie im Koalitionsvertrag angekündigt – gestärkt und finanziell ausgeweitet werden.
Ob das vorgesehene Fördervolumen jedoch ausreicht, um der starken Nachfrage auch künftig gerecht zu werden, bleibt fraglich. In einem gemeinsamen Schreiben an die Mitglieder des Bundestages äußerte eine Allianz von 20 Branchenverbänden deutliche Kritik. Die im Regierungsentwurf bis 2030 eingeplanten Mittel von rund fünf Milliarden Euro reichten laut der Verbände „bei weitem nicht aus, um den Investitionsbooster für die urbane Wärmewende zu zünden“. Stattdessen fordern die Unterzeichnenden, die jährlichen Mittel bereits im Haushalt 2025 auf mindestens 3,5 Milliarden Euro anzuheben.
Im Zuge der geplanten gesetzlichen Verankerung der BEW sehen die Verbände zudem die Chance, bestehende Schwachstellen der Förderrichtlinie zu beseitigen und das Förderprogramm strukturell weiterzuentwickeln.
Das klare Bekenntnis der neuen Bundesregierung zu den Förderinstrumenten KWKG und BEW unterstreicht deren zentrale Bedeutung für die Wärmewende. Damit wird ein wichtiges Signal für den Ausbau und die Transformation der leitungsgebundenen Wärmeinfrastruktur gesetzt. Entscheidend wird nun sein, in welchem Tempo die angekündigten Maßnahmen konkret umgesetzt werden – und ob sie tatsächlich zu der dringend benötigten Planungssicherheit im Wärmesektor beitragen.

Eins ist sicher: Nach einem Gespräch mit den Energieexperten von encadi sind Sie immer schlauer als davor. In nur einem Erstgespräch erfahren Sie:
✓ Wo Sie eventuell noch "Geld verbrennen"
✓ Welche Maßnahmen sich jetzt für Sie lohnen
✓ Wie Sie Fördermittel und Effizienzpotenziale optimal nutzen
✓ Welche drohenden Sanktionen Sie wie vermeiden können
Energie darf kein Blindspot in Ihrem Unternehmen sein.
Lassen Sie uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen.
